Meine jüdischen Eltern, meine polnischen Eltern
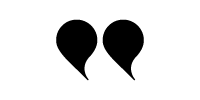
Eine deutsche Streife erschoss meine Mutter auf der arischen Seite. Sie starb, weil sie mich sehen wollte.
Ich wurde am 3. März 1940 in Wilna als Etla Szabad-Milchiger geboren. Wir wohnten in Zwierzyniec. Im September 1941 wurden wir ins Ghetto umgesiedelt. Mein Vater Samuel Murhakiel und seine beiden älteren Brüder wurden bei einer Massenexekution in Ponary erschossen. Meine Mutter wollte mich um jeden Preis retten. Sie beschloss, mich einer polnischen Familie anzuvertrauen, unseren Nachbarn aus Zwierzyniec. Sie glaubte daran, dass sie den Krieg überleben würde und mich dann wieder bei meinen Betreuern abholen könnte.
Ich wurde aus dem Ghetto gebracht und an verabredeter Stelle abgelegt – im Gebüsch zwischen den Häusern. Ich hatte einen weißen Fellmantel an, neben mir lagen ein Zettel, auf dem mein Vorname und mein Geburtsdatum vermerkt waren, sowie eine Tüte Zucker.
Meine Mutter blieb allein im Ghetto zurück, ohne Mann und Kinder. Sie muss ungeheure Sehnsucht nach mir gehabt haben; denn ohne Rücksicht auf die Gefahr bestach sie den Wachposten am Ghettotor und gelangte so auf die arische Seite*. Dort wurde sie von einer deutschen Streife erschossen. Fremde Menschen nahmen ihre Leiche von der Straße und bestatteten sie auf dem jüdischen Friedhof.
Nach dem Tod meiner Mutter beschlossen meine Betreuer, sich des Problems zu entledigen und mich den Deutschen zu übergeben. Sie benachrichtigten die Gendarmerie, dass sie auf der Straße ein jüdisches Kind gefunden hätten. Mein Schicksal sollte sich in einer Schmiede entscheiden, wo jener Mann arbeitete, dem ich anvertraut worden war. Dort wartete ich auf die Ankunft des Gendarmen.
wiadomili żandarmerię, że znaleźli na ulicy żydowskie dziecko. Mój los miał przypieczętować się w kuźni, gdzie pracował mężczyzna, któremu zostałam oddana pod opiekę. Tam czekałam na przyjście żandarma.
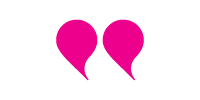
Mich rettete Władysław Seroczyński, der später mein Vater wurde.
Als er mich dort liegen sah, wusste er sofort, dass er nicht zulassen konnte, mich den Deutschen zu übergeben – was auch immer die Folgen sein mochten. Er nahm den Gendarmen beiseite und erklärte ihm lange etwas auf Deutsch. Schließlich drehte sich der Deutsche um, sah mich an und … ging aus der Tür.
Und so wurde ich das Kind von Maria und Władyslaw Seroczyński. Meine Adoptiveltern hatten keine eigenen Kinder, und tauften mich gleich im November 1944 als ihre Tochter. Viele Jahre lang war der Taufschein das einzige Dokument, dass meine Existenz bezeugte. Er diente später als Grundlage für meine Geburtsurkunde. Ich habe mir wiederholt überlegt, ob ich tatsächlich am 3. März 1940 geboren bin. Ich werde es nie erfahren; denn der Zettel, auf dem meine leibliche Mutter mein Geburtsdatum vermerkt hatte, ist abhanden gekommen, und diejenigen, die von meiner Geburt wussten, leben nicht mehr.
Nach Kriegsende wollten meine neuen Eltern sich möglichst rasch wieder in Polen befinden und fuhren mit dem ersten Transport dorthin. Sie wollten alle Spuren verwischen, die davon zeugten, dass ich ein jüdisches Adoptivkind war. Die Repatrianten aus Wilna wurden in Pomorze [Pommerellen bzw. Pommern] angesiedelt; auch mein Patenonkel kam dorthin, der Neffe von Papa Seroczyński – und mit ihm das Geheimnis meiner Herkunft, das so, von Mund zu Mund weitergegeben, an den Ort gelangte, in dem ich mit meinen Eltern lebte.
Eines Tages tauchten zwei Männer bei uns auf und erkundigten sich nach mir. Mein Vater war sehr erregt, schloss sich mit ihnen im Zimmer ein, wo sie lange miteinander sprachen. Offensichtlich hatte er sie davon überzeugen können, dass ich keine Jüdin war; denn sie ließen sich nicht wieder blicken.
Meine Eltern wollten sich nicht von mir trennen. Für sie war ich ihr eigenes Kind, das sie liebten. Sie selbst sagten mir nie die Wahrheit über meine Herkunft, obwohl die ganze Stadt Bescheid wusste. Solange ich klein war, begriff ich die Anspielungen und Sticheleien nicht, die ich zu hören bekam. Als ich älter wurde, fiel mir jedoch auf, das irgendetwas mit mir nicht stimmen musste. Als ich meine Mutter fragte, ob ich wirklich ihre Tochter sei, fing sie an zu weinen. Da ich sie nicht verletzen wollte, fragte ich nicht weiter.
Meine Eltern waren herzensgute Menschen, die für das Schicksal von Kindern empfänglich waren. Vor dem Krieg hatten sie in ihrem Haus mehrere Neffen meiner Mutter großgezogen. Dann adoptierten sie mich und ein paar Jahre später nahmen sie einen kleinen Jungen, einen entfernten Verwandten, zu sich.
Meine Mutter war streng und anspruchsvoll. Wahrscheinlich war sie selbst auch so erzogen worden. Mein Vater dagegen liebte es, Kinder um sich zu haben. Auf dem Hof spielte er mit allen kleinen Kindern, die ihn dann auch „Papa“ nannten.
Der Tod meines Vaters ging mir sehr nahe. Ich konnte mir nicht vorstellen, auch noch meine Mutter zu verlieren. Zum Glück war ihr ein langes Leben vergönnt. Wir wohnten nicht zusammen, aber ich habe sie täglich besucht. Sie war dankbar für meine Fürsorge und sagte immer wieder, dass sie ohne mich schon längst nicht mehr leben würde. Sie starb unter meinen Händen.

Jadwiga Hreniak
schloss ein Medizinstudium ab und arbeitete ihr ganzes Leben lang als Hebamme. Sie ist Mitglied der Gesellschaft „Kinder des Holocaust“ in Polen. Sie hat zwei Kinder und fünf Enkel.
Eltern

Marianna
Seroczyńska
Seroczyńska
(1902–1987)
Sie hatte keine eigenen Kinder, doch für eine Reihe von Kindern, die Fürsorge brauchten, war sie die Mutter. Ihr habe ich zu verdanken, dass ich Hebamme wurde.

Pola
Milchiger geb. Szabad
Milchiger geb. Szabad
(zm. 1941)

Władysław
Seroczyński
Seroczyński
(1901–1966)
Vor dem Krieg war er Berufsoffizier. Danach arbeitete er bei der Bahn. Er rettete mir das Leben und gab mir ein Zuhause und Liebe.

Samuel
Milchiger
Milchiger
(zm. 1941)
